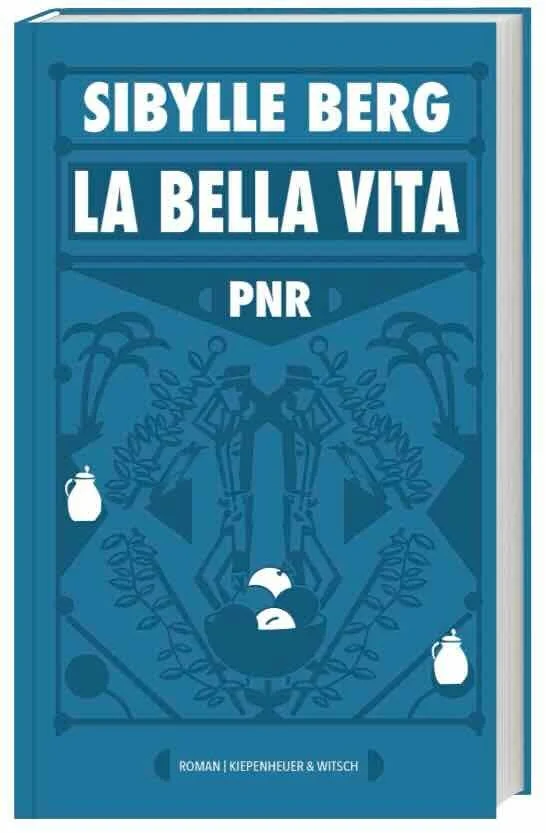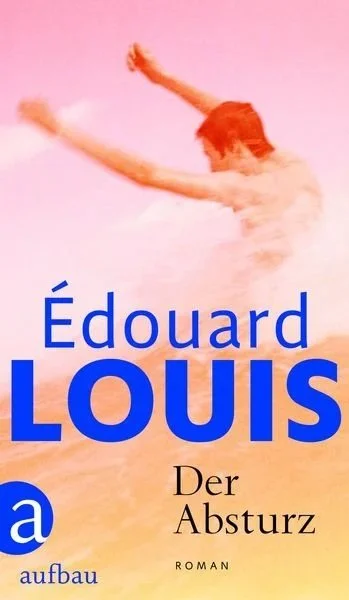George Sand und ihr unerhörter Bildungsroman: Ist „Nanon“ Kanon? Nicht so wirklich. Dennoch hat Elisabeth Edl den letzten Roman George Sands über eine Bäuerin in der Französischen Revolution neu übersetzt und herausgegeben.
Dass George Sand eine Frau war, das hatte sich schon herumgesprochen, als Ende Dezember 1872 ihr Roman „Nanon“ erschien. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie die Öffentlichkeit lange rätseln lassen, wer wohl hinter dem Pseudonym steckte. Ein Mann musste es sein, darauf einigten sich die meisten, wo die Texte doch so gut geschrieben waren. Dass häufig eine weibliche Figur im Zentrum stand, deutete einfach auf sein besonderes Einfühlungsvermögen hin.
Auch „Nanon“ schrieb Sand aus der Perspektive einer Frau. Nach ihr benannte sie den Roman auch, dem sie zuerst den Titel „Die erfolgreiche Bäuerin“, später „Die Marquise“ geben wollte. Die Ich-Erzählerin rahmt und kommentiert ihren Bericht selbst auf der Metaebene: 75-jährig schreibt diese Nanette de Franqueville im Jahr 1850 ihre Lebenserinnerungen nieder, nicht in literarischer Absicht, sondern für Kinder und Enkel. Besonders geht es darum, wie sie heranwachsend die Französische Revolution erlebte – oder gerade eben nicht erlebte, denn am Land unter Analphabeten, entmachteten Geistlichen und nur noch rein theoretisch Adeligen kommen die historischen Geschehnisse erst verspätet an und werden nicht so richtig verstanden.
Dessen ungeachtet legt Nanon einen erstaunlichen sozialen Aufstieg hin. Anfangs ist sie eine verwaiste Leibeigene mit bäuerlichem Hintergrund, ein Schaf ihr ein und alles. Die Bekanntschaft mit dem als Zögling in die ortseigene Abtei abgeschobenen Marquis-Sohn Émilien entfacht ihren Lernwillen. Sie eignet sich das Lesen und Schreiben an und pflegt einen gewissen Geschäftssinn, der sie im Zuge der Revolution zu einer allseits beliebten, wohlhabenden Unternehmerin macht. Eine weitere Entwicklung Nanons mutet aus heutiger Sicht geradezu grotesk an: Sie braucht sehr, sehr lange, bis sie akzeptiert, dass der von ihr abgöttisch verehrte Émilien sie trotz des Standesunterschieds heiraten will.
Weiterlesen in der Buchkultur 222